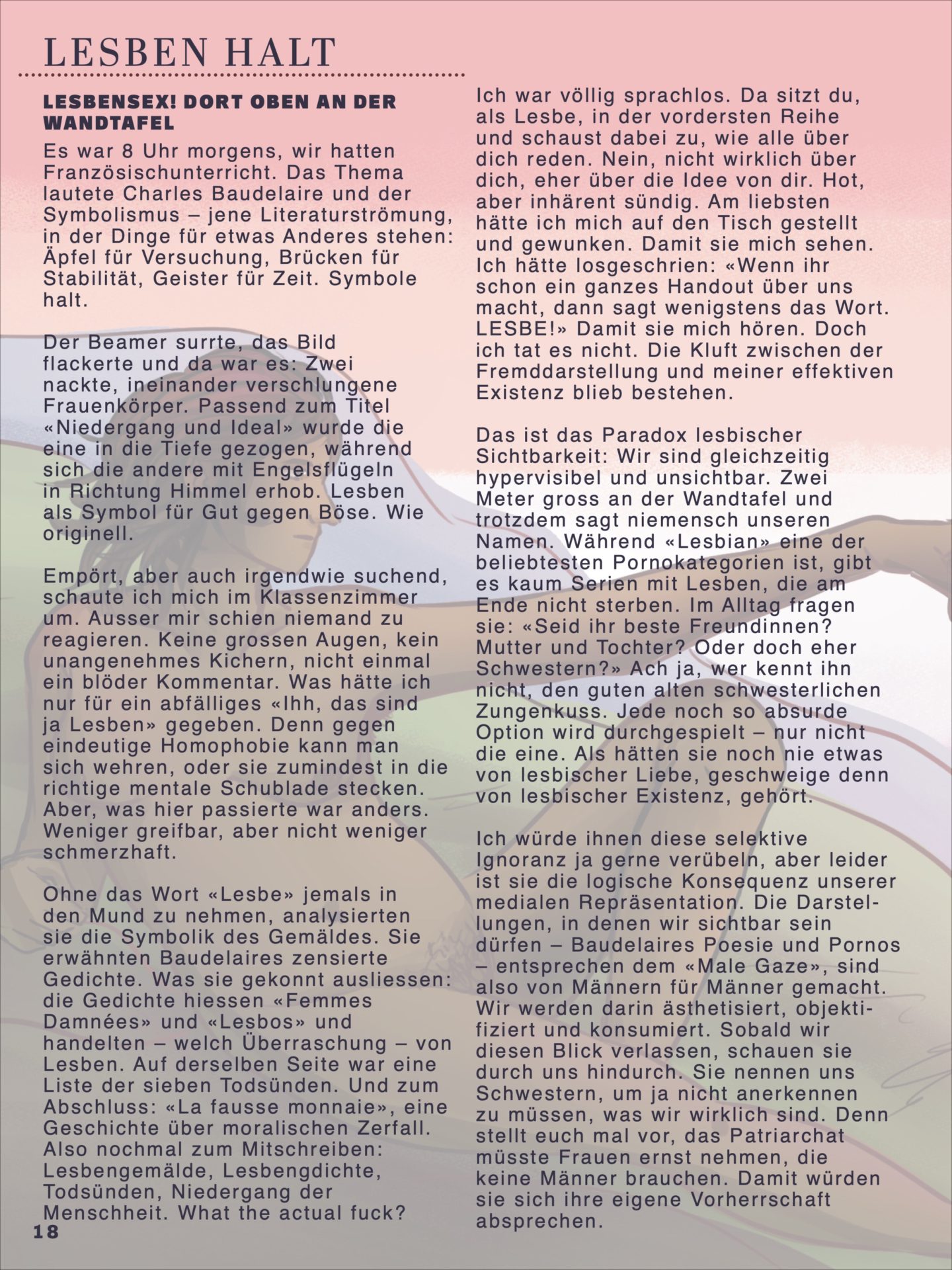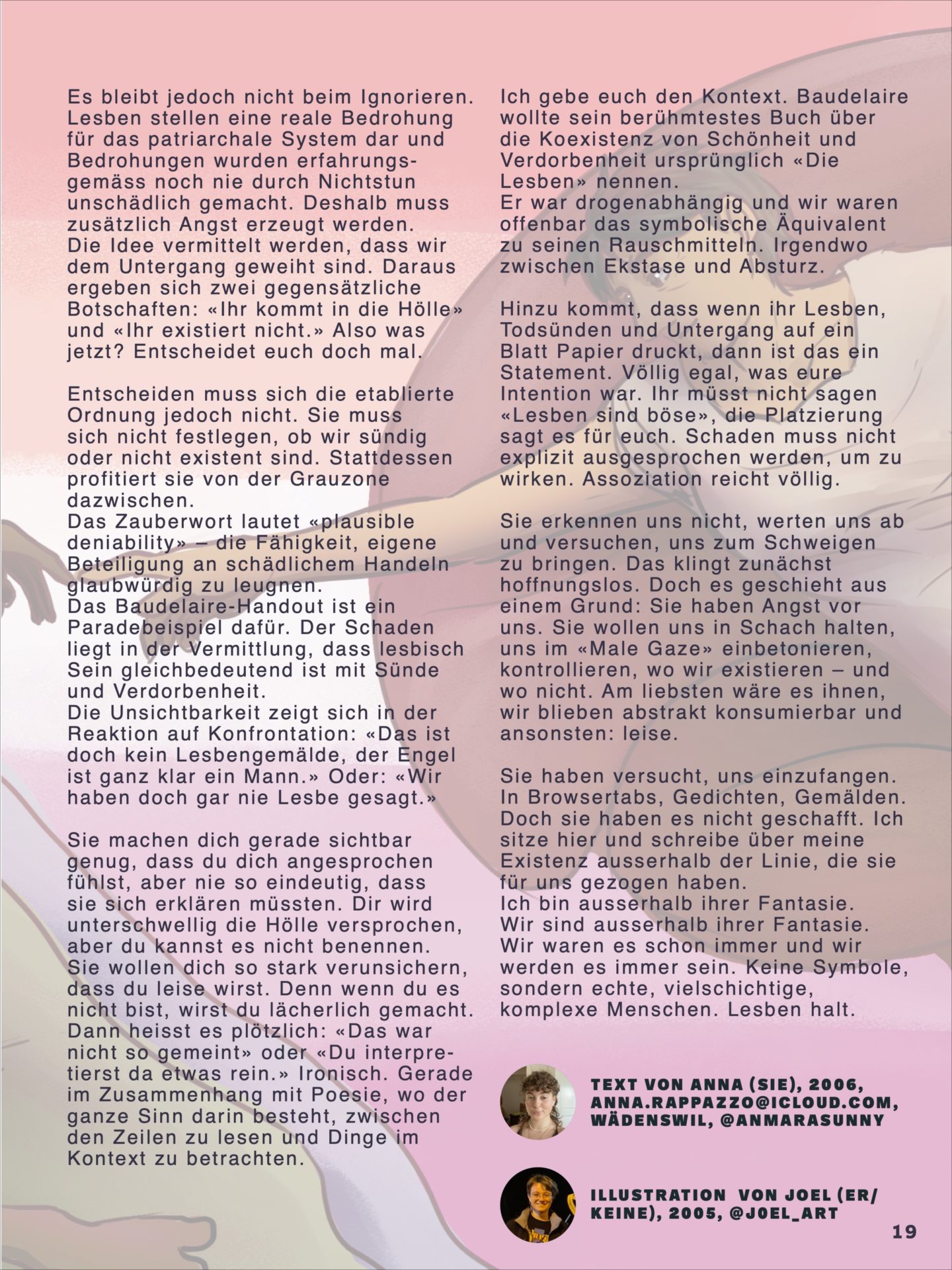Es war 8 Uhr morgens, wir hatten Französischunterricht. Das Thema lautete Charles Baudelaire und der Symbolismus – jene Literaturströmung, in der Dinge für etwas Anderes stehen: Äpfel für Versuchung, Brücken für Stabilität, Geister für Zeit. Symbole halt.
Der Beamer surrte, das Bild flackerte und da war es: Zwei nackte, ineinander verschlungene Frauenkörper. Passend zum Titel «Niedergang und Ideal» wurde die eine in die Tiefe gezogen, während sich die andere mit Engelsflügeln in Richtung Himmel erhob. Lesben als Symbol für Gut gegen Böse. Wie originell.
Empört, aber auch irgendwie suchend, schaute ich mich im Klassenzimmer um. Ausser mir schien niemand zu reagieren. Keine grossen Augen, kein unangenehmes Kichern, nicht einmal ein blöder Kommentar. Was hätte ich nur für ein abfälliges «Ihh, das sind ja Lesben» gegeben. Denn gegen eindeutige Homophobie kann man sich wehren, oder sie zumindest in die richtige mentale Schublade stecken. Aber, was hier passierte war anders. Weniger greifbar, aber nicht weniger schmerzhaft.
Ohne das Wort «Lesbe» jemals in den Mund zu nehmen, analysierten sie die Symbolik des Gemäldes. Sie erwähnten Baudelaires zensierte Gedichte. Was sie gekonnt ausliessen: die Gedichte hiessen «Femmes Damnées» und «Lesbos» und handelten – welch Überraschung – von Lesben. Auf derselben Seite war eine Liste der sieben Todsünden. Und zum Abschluss: «La fausse monnaie», eine Geschichte über moralischen Zerfall. Also nochmal zum Mitschreiben: Lesbengemälde, Lesbengdichte, Todsünden, Niedergang der Menschheit. What the actual fuck?
Ich war völlig sprachlos. Da sitzt du, als Lesbe, in der vordersten Reihe und schaust dabei zu, wie alle über dich reden. Nein, nicht wirklich über dich, eher über die Idee von dir. Hot, aber inhärent sündig. Am liebsten hätte ich mich auf den Tisch gestellt und gewunken. Damit sie mich sehen. Ich hätte losgeschrien: «Wenn ihr schon ein ganzes Handout über uns macht, dann sagt wenigstens das Wort. LESBE!» Damit sie mich hören. Doch ich tat es nicht. Die Kluft zwischen der Fremddarstellung und meiner effektiven Existenz blieb bestehen.
Das ist das Paradox lesbischer Sichtbarkeit: Wir sind gleichzeitig hypervisibel und unsichtbar. Zwei Meter gross an der Wandtafel und trotzdem sagt niemensch unseren Namen. Während «Lesbian» eine der beliebtesten Pornokategorien ist, gibt es kaum Serien mit Lesben, die am Ende nicht sterben. Im Alltag fragen sie: «Seid ihr beste Freundinnen? Mutter und Tochter? Oder doch eher Schwestern?» Ach ja, wer kennt ihn nicht, den guten alten schwesterlichen Zungenkuss. Jede noch so absurde Option wird durchgespielt – nur nicht die eine. Als hätten sie noch nie etwas von lesbischer Liebe, geschweige denn von lesbischer Existenz, gehört.
Ich würde ihnen diese selektive Ignoranz ja gerne verübeln, aber leider ist sie die logische Konsequenz unserer medialen Repräsentation. Die Darstellungen, in denen wir sichtbar sein dürfen – Baudelaires Poesie und Pornos – entsprechen dem «Male Gaze», sind also von Männern für Männer gemacht. Wir werden darin ästhetisiert, objektifiziert und konsumiert. Sobald wir diesen Blick verlassen, schauen sie durch uns hindurch. Sie nennen uns Schwestern, um ja nicht anerkennen zu müssen, was wir wirklich sind. Denn stellt euch mal vor, das Patriarchat müsste Frauen ernst nehmen, die keine Männer brauchen. Damit würden sie sich ihre eigene Vorherrschaft absprechen.
Es bleibt jedoch nicht beim Ignorieren. Lesben stellen eine reale Bedrohung für das patriarchale System dar und Bedrohungen wurden erfahrungsgemäss noch nie durch Nichtstun unschädlich gemacht. Deshalb muss zusätzlich Angst erzeugt werden. Die Idee vermittelt werden, dass wir dem Untergang geweiht sind. Daraus ergeben sich zwei gegensätzliche Botschaften: «Ihr kommt in die Hölle» und «Ihr existiert nicht.» Also was jetzt? Entscheidet euch doch mal.
Entscheiden muss sich die etablierte Ordnung jedoch nicht. Sie muss sich nicht festlegen, ob wir sündig oder nicht existent sind. Stattdessen profitiert sie von der Grauzone dazwischen. Das Zauberwort lautet «plausible deniability» – die Fähigkeit, eigene Beteiligung an schädlichem Handeln glaubwürdig zu leugnen. Das Baudelaire-Handout ist ein Paradebeispiel dafür. Der Schaden liegt in der Vermittlung, dass lesbisch Sein gleichbedeutend ist mit Sünde und Verdorbenheit. Die Unsichtbarkeit zeigt sich in der Reaktion auf Konfrontation: «Das ist doch kein Lesbengemälde, der Engel ist ganz klar ein Mann.» Oder: «Wir haben doch gar nie Lesbe gesagt.»
Sie machen dich gerade sichtbar genug, dass du dich angesprochen fühlst, aber nie so eindeutig, dass sie sich erklären müssten. Dir wird unterschwellig die Hölle versprochen, aber du kannst es nicht benennen. Sie wollen dich so stark verunsichern, dass du leise wirst. Denn wenn du es nicht bist, wirst du lächerlich gemacht. Dann heisst es plötzlich: «Das war nicht so gemeint» oder «Du interpretierst da etwas rein.» Ironisch. Gerade im Zusammenhang mit Poesie, wo der ganze Sinn darin besteht, zwischen den Zeilen zu lesen und Dinge im Kontext zu betrachten.
Ich gebe euch den Kontext. Baudelaire wollte sein berühmtestes Buch über die Koexistenz von Schönheit und Verdorbenheit ursprünglich «Die Lesben» nennen. Er war drogenabhängig und wir waren offenbar das symbolische Äquivalent zu seinen Rauschmitteln. Irgendwo zwischen Ekstase und Absturz.
Hinzu kommt, dass wenn ihr Lesben, Todsünden und Untergang auf ein Blatt Papier druckt, dann ist das ein Statement. Völlig egal, was eure Intention war. Ihr müsst nicht sagen «Lesben sind böse», die Platzierung sagt es für euch. Schaden muss nicht explizit ausgesprochen werden, um zu wirken. Assoziation reicht völlig.
Sie erkennen uns nicht, werten uns ab und versuchen, uns zum Schweigen zu bringen. Das klingt zunächst hoffnungslos. Doch es geschieht aus einem Grund: Sie haben Angst vor uns. Sie wollen uns in Schach halten, uns im «Male Gaze» einbetonieren, kontrollieren, wo wir existieren – und wo nicht. Am liebsten wäre es ihnen, wir blieben abstrakt konsumierbar und ansonsten: leise.
Sie haben versucht, uns einzufangen. In Browsertabs, Gedichten, Gemälden. Doch sie haben es nicht geschafft. Ich sitze hier und schreibe über meine Existenz ausserhalb der Linie, die sie für uns gezogen haben. Ich bin ausserhalb ihrer Fantasie. Wir sind ausserhalb ihrer Fantasie. Wir waren es schon immer und wir werden es immer sein. Keine Symbole, sondern echte, vielschichtige, komplexe Menschen. Lesben halt.